Beiträge zur geistigen Situation der Gegenwart Jg. 4 (2003), Heft 4 - (http://www.marburger-forum.de/mafo/heft2003-04/Bethge_indische_Harfe.htm)
![]()
Beiträge zur geistigen
Situation der Gegenwart Jg. 4 (2003), Heft 4 - (http://www.marburger-forum.de/mafo/heft2003-04/Bethge_indische_Harfe.htm)
Hans Bethge: Die indische Harfe. Nachdichtungen indischer Lyrik. 4. vom Autor überarbeitete und erweiterte Auflage der zuerst 1913 erschienenen Ausgabe, YinYang Media Verlag, Kelkheim 2002, 131 + XVI Seiten, ISBN 3-9806799-8-5, 12,50 €
Dieser Band - der sechste der Werkausgabe - enthält überwiegend Bethges Nachdichtungen indischer Liebeslyrik der klassischen Zeit. "Die Verse des vorliegenden Buches gehen zum größten Teil auf die deutschen Prosatexte zurück, die Otto Böhtlingk in seinem dreibändigen Werk Indische Sprüche zugleich mit den entsprechenden Sanskrit-Texten dargeboten hat", schreibt Bethge im Geleitwort von 1943 (S. 126). Die "klassische Blüte der indischen Lyrik und der indischen Kunstdichtung überhaupt fällt in die Zeit zwischen dem vierten und siebenten Jahrhundert. In ihr herrscht eine völlige weltliche Atmosphäre (...)" (S. 121), die Bethge auf seine unvergleichliche Weise so beschreibt: "In dieser Lyrik weht nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich eine tropische Luft, man ist gleichsam umschmeichelt von einem lauen Bad, die Glieder lösen sich, der Wille dämmert ein. Es herrscht eine wie von Gold und Sandelduft umflossene, ganz unverschleierte Sinnlichkeit, eine glühende Pracht exotischer Farben" (S. 125).
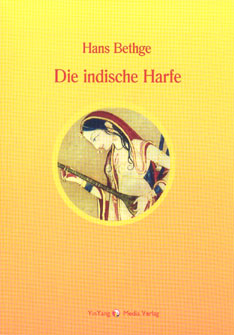
In den Dichtungstheorien jener Jahrhunderte werden, wie Glasenapp in "Die theoretischen Grundlagen der indischen Kunstdichtung" (a. a. O., S. 193 ff) ausführt, die Elemente der Lyrik genau untersucht. Zu ihnen gehören Hyperbeln, Metaphern, Wortspiele etc., also stilistische Figuren, ebenso jedoch die Unwägbarkeiten der Sprache, die Gefühle, Stimmungen, ja letztlich einen überpersönlichen, göttlichen Genuss im Hörer erzeugen können. Auch das verfeinerte Gedicht, das bestimmten Publikumserwartungen entsprechen muss, ist also immer mehr, als ein kompliziertes Konglomerat von stilistisch-rhetorischen Formeln. Das eigentlich Erotische der indischen Liebeslyrik entsteht zwischen den geläufigen Bildern und Satzwendungen und einer Inspiration, die, synästhetisch gesteigert, die Atmosphäre des Verlangens, der Erregung und Stillung sinnlich-geistiger Bedürfnisse, gleichsam unmittelbar vernehmbar macht.
Liest man die Nachdichtungen Bethges und erinnert sich daran, dass er nur Prosatexte vor Augen hatte, so glaubt man mit wachsender Bewunderung, er habe den Ton dieser Lyrik kongenial getroffen.
Regenzeit (Kalidasa) "Beschwert von Blüten, beugen sich die Zweige / Der Bäume nieder, silberne Regentropfen / Glänzen darüber hin, ein schwüler Duft / Ergießt sich durch den feuchten Raum und bringt / Die Liebenden voll Sehnsucht zueinander."
Die ganze Natur ist Zeugung. Der Regen des Himmels und die Blüten der Erde lassen in ihrer Vereinigung einen Duft entstehen, der wie das erotische Stimulans schlechthin die Sehnsucht der Liebenden bis in ein göttliches Übermaß steigert. Die Sexualität der Menschen wird so zum Abbild eines naturhaft-transzendenten Geschehens.
Sommer (Kalidasa) "Der Duft nach Sandel, den die seidnen Fächer / Über die Brüste schöner Frauen wehn, / Die Perlen auf der braunen Haut, Gesänge, / Der Klang der Harfen und das Lied der Vögel, - / Das alles weckt den Gott der Liebe auf, / Und neue Lust und neue Qual beginnt."
Sommer (Kalidasa) "Der Nächte dunkle Schatten sind verschwunden, / Es glänzt der Mond wie Gold. Die Wasserkünste / Verbreiten Kühle durch die Marmortüren, / Und Mädchen, in dem Schmuck von Edelsteinen, / Ruhn aus und dehnen wollüstig die Glieder / Durch die ersehnte frische Luft der Nacht."
Der Kampf der polaren Weltkräfte ist in der Erotik zum Spiel verfeinert, in dem "Lust" und "Qual" sich zum Gesamtgefühl einer sinnlich-beseelten Schöpfung verbinden. Im gesteigerten mystischen Augenblick kann der Kosmos als Geist erfahren werden, wie im Erleben von Lust die Körper als der eine Eros. Beide Male wird in der jeweils spezifischen Begegnung - mit dem Gott, dem oder der Geliebten - ein sichtbar-unsichtbares Wesen erzeugt, das eben die "Stimmung" oder numinose Atmosphäre der Begegnung ist.
Zweierlei Glück (Bhartrihari) "Glücklich die einen: die, dem Hang zur Welt / entsagend, aller Leidenschaften bar, / Nur der Erkenntnis Gottes hingegeben, / Die Tage ihrer Jugend in der Tiefe / Der heiligen Wälder still und fromm verbringen. // Glückselig auch die andern: die am Abend / Die lachende Geliebte, deren Brüste / Gleich hohen Urnen in die Lüfte starren, / Heiter umarmen und auf weichem Lager / Der Liebe ihres Seins Erfüllung sehn."
Bhartrihari hat dieses gleiche Bedeuten von Gotteserkenntnis und wirklichem erotischen Erleben wohl gesehen, aber in seinem Hin- und Herpendeln zwischen klösterlicher Einsamkeit und Weltzugewandtheit doch nicht in Balance bringen können. Amaru spricht in "Glück" auf keineswegs häretische Weise aus, dass die Seligkeit der Liebe etwas Göttliches hat:
"Auf lange leuchte dir das reizende / Gesicht des schlanken Mädchens: Beim Genuss / Der Liebe schweb es vor dir, eingerahmt / Von den in Unordnung geratnen Locken, / Geschmückt mit Ohrgehängen, welche schwanken, / Und auf der Stirn bedeckt mit feinen Perlen / Wollüstigen Schweißes, und die Augen glänzen / Gar süß ermattet nach dem Liebesspiel ... // So lang dir dieses wird, was brauchst du da / Vischnu und Schiwa und die andern Götter?"
Die orthodoxe Kirchenfrömmigkeit hat zu allen Zeiten in der Mystik etwas Bedrohliches gesehen, weil sie in der gesteigerten Gottesliebe zurecht etwas Heidnisch-Erotisches ausgemacht hat. Eben das fehlt den heutigen christlichen Gottesvorstellungen, die deswegen so blass sind. In Bethges "indischer Harfe" begegnen wir einer erotisch-polytheistischen Welt, die von der unsrigen nur einerseits sehr weit entfernt ist. Auch die omnipräsente nachmoderne Sexualität kann sich erotisieren, um so gesteigert zu erfahren, was Lust sein kann. Die in diesem Buch versammelten Gedichte vermitteln uns eine bildhafte sinnliche Präsenz davon.
Max LorenzenDiesen Artikel als Word-Dokument herunterladen